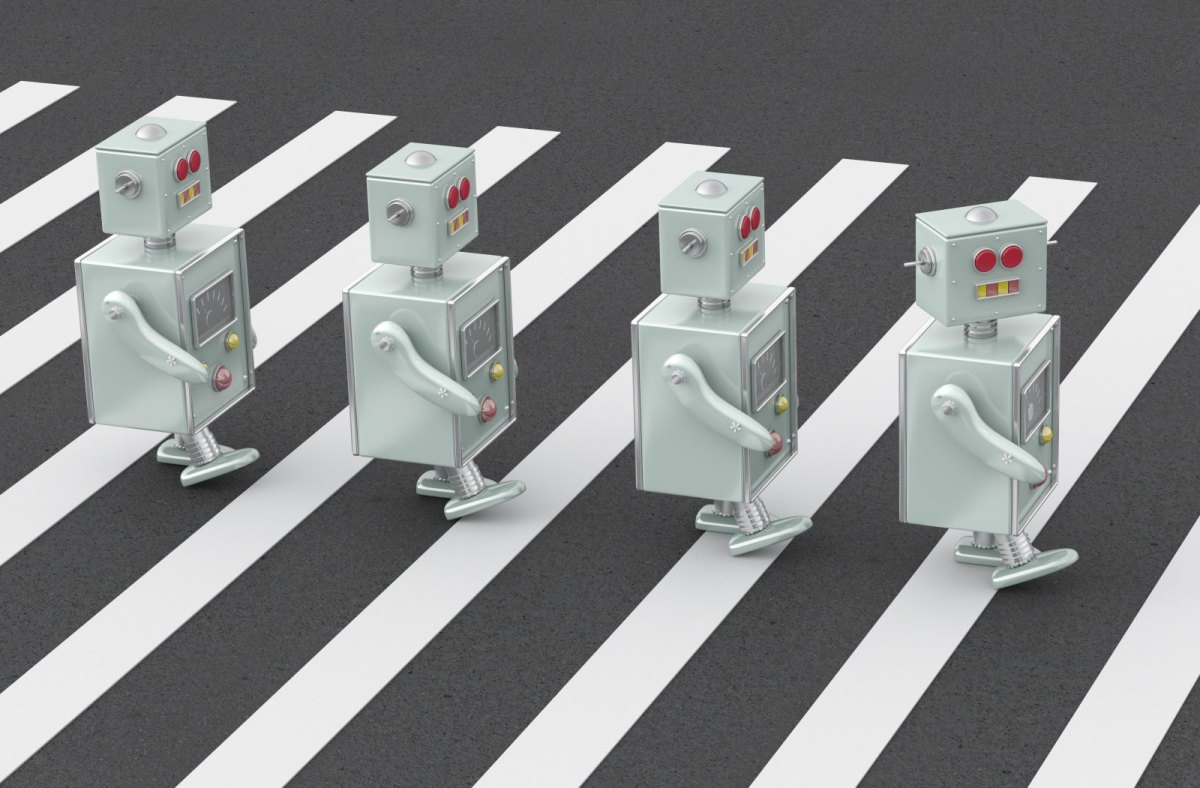Roboter sehen nicht immer so stilvoll und futuristisch aus wie der Terminator, die Transformers oder der Spot Mini von Boston Dynamics, vor dem sich Zuschauer so gruseln. Roboter können auch aussehen wie aus dem Ein-Euro-Shop, unschön und einfach. Sind sie allein auf sich gestellt, können sie sich nicht frei im Raum bewegen. Sie können nicht kommunizieren. Das Einzige: Sie können mit ihren Armen flattern, wie ein Käfer, der auf dem Rücken liegt.
„Smarticles“ (die Kurzform von „smart active particles“) heißen diese kleinen Roboter, die, so bewegungsunfähig sie auch sein mögen, als Gruppe dann doch zusammenarbeiten und quasi aus dem Nichts etwas schaffen können. An verschiedenen Universitäten werden sie derzeit erforscht, allen voran das Georgia Institute of Technology in Atlanta, USA. Unter dem Titel „Locomoting robots composed of immobile robots“ (auf deutsch etwa: „Sich fortbewegende Roboter aus unbeweglichen Robotern zusammengesetzt“) untersuchte ein Forscherteam das Schwarmverhalten der kleinen Maschinen.
Schwarmverhalten wie in „Spider-Man“
Ihre Experimente zeigten: Die Smarticles legen im Schwarm eine Gruppendynamik an den Tag, die ähnlich der von Bienen- oder Ameisenkolonien (wie hier beschrieben) ist. Sind sie getrennt, verhält sich jedes einzelne Smarticle nach demselben, unveränderlichen Prinzip, keine Abweichungen, aber auch kein zielgerichtetes Verhalten.
Kommen sie jedoch zu einer Gruppe zusammen, lassen sie plötzlich ein komplexes Verhalten erkennen, und zwar ohne jegliche zentralisierte Führung und Ausrichtung, also ohne einen Einfluss von außen. Steuern lässt sich das Ganze damit allerdings noch nicht. Das anschaulichste Beispiel dafür liefern die Forscher des Georgia Tech selbst – mit einem Clip aus „Spider-Man 3“. Darin setzt sich der Super-Gegner Sandman, wie der Name bereits verspricht, aus kleinsten Sandkörnern zusammen. So in etwa lässt sich der Verhalten der Smarticles visualisieren.
Nun will man als Forscher aber genau das ändern. Vor allem Computerwissenschaftlern geht es um die Frage nach dem Algorithmus: Was sind die Basis-Instruktionen, mit denen Individuen, basierend auf ihren spärlichen Daten, in einem Schwarm agieren können, die zwangsläufig zu dem gewollten, komplexen Verhalten führen? Das Team vom Georgia Tech hat einen solchen Algorithmus im vergangenen November veröffentlicht. Er stellt sicher, dass sich ein Schwarm aus individuellen Partikeln in einer koordinierten Art und Weise verhält.
Mehr als Ameisen und Bienen
Kurz gesagt: Es geht um sich selbst organisierende Partikel, in diesem Fall die kleinen Roboter namens Smarticles. Deren Zielrichtung von außen mit einem Algorithmus steuern zu können ist das Anliegen der Forscher. Auch an der Harvard University werden diese sogenannten „Kilobot swarms“ untersucht und an der University of Colorado forscht man an „droplet-size robots“ (auf deutsch: Tröpfchen-große Roboter). Wie häufig in IT-getriebenen Wissenschaften sollen Phänomene aus der Natur, also beispielsweise das Schwarmverhalten von Bienen oder Ameisen künstlich nachgeahmt werden, beispielsweise mit den kleinen Robotern.
Die Übertragung des Wissens aus den Studien kann sogar noch alltagsbezogener aussehen. In den 1960er Jahren erforschte der Ökonom Thomas Schelling das Phänomen der Ghettobildung, in den Großstädten der USA seit der Gründungszeit durch Einwanderungswellen weit verbreitet. Ethnische, kulturelle oder soziale Gruppen konzentrieren sich dabei exklusive auf bestimmte Gebiete oder Bezirke, was zur Bildung von Parallelgesellschaften führen kann. Schelling wollte wissen, ob sich eine Ghettobildung anhand von Hautfarben auch ohne einen zentralen Einfluss durchsetzt. Seine Experimente bestätigten diese Vermutung: Obwohl sich Individuen der untersuchten ethnischen Gruppen verteilten statt ghettoisierten, zog es die Mehrheit in eine Richtung.
Kommen sich immer näher: Physik und Computerwissenschaft
Das gleiche Prinzip zeigte sich auch im Schwarmverhalten der Smarticles. In der Robotik-„Sozialstudie“ allerdings konnte sich das Individuum besser platzieren. Denn eines Tages, als die Forscher die chaotische Formation des Schwarms beobachteten, war die Batterie eines der smarten Partikel leer. Plötzlich und unerwartet formierte sich der Rest neu und richtete sich auf den inaktiven kleinen Roboter aus. Vor allem dieses Ereignis führt zur Entwicklung des Algorithmus‘, der irgendwann fähig sein wird, einen idealen Schwarm in eine von ihm gewollte Richtung zu bewegen – ohne den Tod einer Batterie. „Wir wollen, dass es bewusster passiert“, so die Wissenschaftler. Und so kommen sich schließlich die Computerwissenschaft und die Physik immer näher.